Figuren, die leben – mit diesen Tipps machst du deine Charaktere dreidimensional
Du kannst noch so spannend plotten, wenn deine Figuren flach bleiben, verliert deine Geschichte an Kraft. Leser:innen wollen Charaktere, die lebendig wirken. Die Ecken und Kanten haben. Die man sich vorstellen und fühlen kann. Aber wie genau schaffst du das? Der Schlüssel liegt in einer klugen Kombination aus direkter und indirekter Charakterisierung.
„Eine gute Figur ist kein Abziehbild, sie ist ein Mensch aus Tinte und Tiefe.“
Was ist Charakterisierung überhaupt?
Charakterisierung ist alles, was deine Figur greifbar macht: Aussehen, Verhalten, Gedanken, Geschichte, Sprache, Werte. Je glaubwürdiger und vollständiger das Bild, desto mehr fühlt sich dein Lesepublikum mit deiner Figur verbunden.
Dazu hast du zwei grundlegende Werkzeuge:
Direkte Charakterisierung: Wenn du (oder andere Figuren) erzählen
Bei der direkten Charakterisierung sagst du klar, wie jemand ist. Du kannst das als Erzählinstanz tun oder durch die Wahrnehmung anderer Figuren.
Beispiele:
- „Gerti war groß, schlank und wütend.“
- „Der Peter ist süß, oder? Ich hab ihn auf der Party gesehen, total charmant.“
Diese Form des Tellings ist oft nützlich, gerade wenn du schnell Informationen liefern willst. Zum Beispiel:
- Beruf
- Alter
- äußere Merkmale
- klare Fakten
Aber: Sie bleibt oft an der Oberfläche.

Indirekte Charakterisierung: Wenn deine Figur sich selbst zeigt
Bei der indirekten Charakterisierung erleben Leser:innen deine Figur durch ihr Handeln, Sprechen, Denken und ihre Wirkung auf andere.
Beispiel:
„Sie wartete, bis die Mutter die Tür geschlossen hatte, kniff dann das kleine Geschwisterchen in den Arm und lächelte, als diesem Tränen in die Augen stiegen.“
Das ist kraftvoll. Du musst nicht sagen, dass Anna gemein ist, du zeigst es. Und Leser:innen fühlen es. Indirekte Charakterisierung wirkt oft viel stärker, weil sie die Fantasie aktiviert. Der Leser wird zum Mitgestalter.
„Zeige mir, wer deine Figur ist und ich glaube es dir. Sag es mir und ich zweifle.“
Wann solltest du was verwenden?
Du brauchst beide Formen,– aber mit Maß und Fokus.
Direkte Charakterisierung
- für Fakten
- für klare Infos am Anfang
- zum Orientieren
Indirekte Charakterisierung
- für Entwicklung
- für Tiefe
- für emotionale Wirkung
- für Subtext
Indirektes Erzählen verlangt mehr Aufwand, aber es zahlt sich aus. Denn Figuren, die sich selbst zeigen, bleiben im Gedächtnis.
Lebendige Figuren entstehen zwischen Zeigen und Sagen
Du kannst nicht alles zeigen. Und du musst nicht alles sagen. Aber wenn du beides gezielt mischst, bekommen deine Figuren Leben, Ecken, Schatten und Persönlichkeit.
„Die beste Charakterisierung ist die, die man nicht als solche erkennt. sondern erlebt.“
Du willst lernen, wie du starke Figuren aufbaust, deine Geschichte dramaturgisch führst oder mit KI deinen Schreibprozess ergänzt? Dann komm in den Bookerfly Club: www.bookerfly.de oder entdecke die KI-Schreibschule mit Janet Zentel & Juri Pavlovic: https://go.bookerfly.de/buch-schreiben-mit-ki-club/


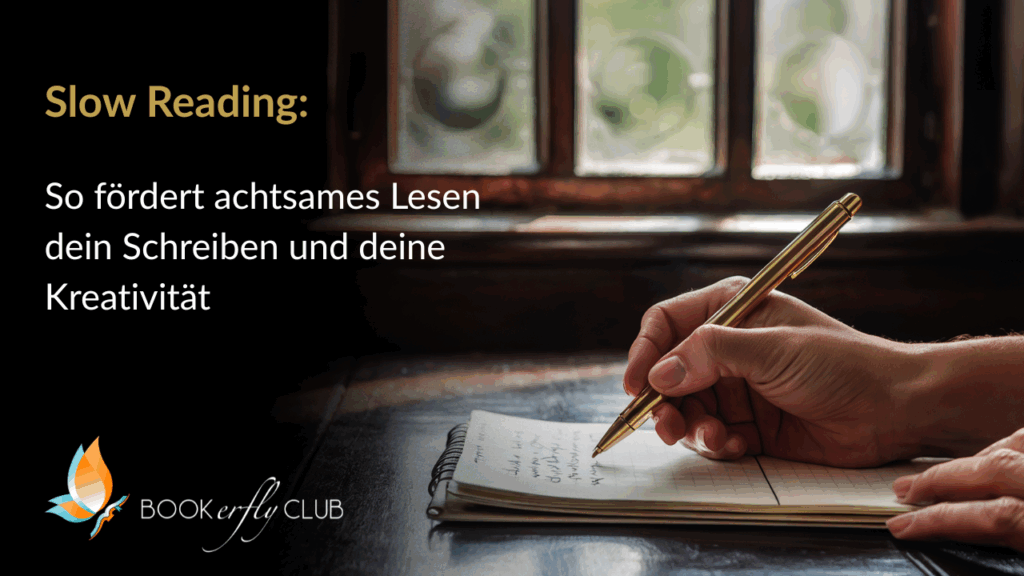

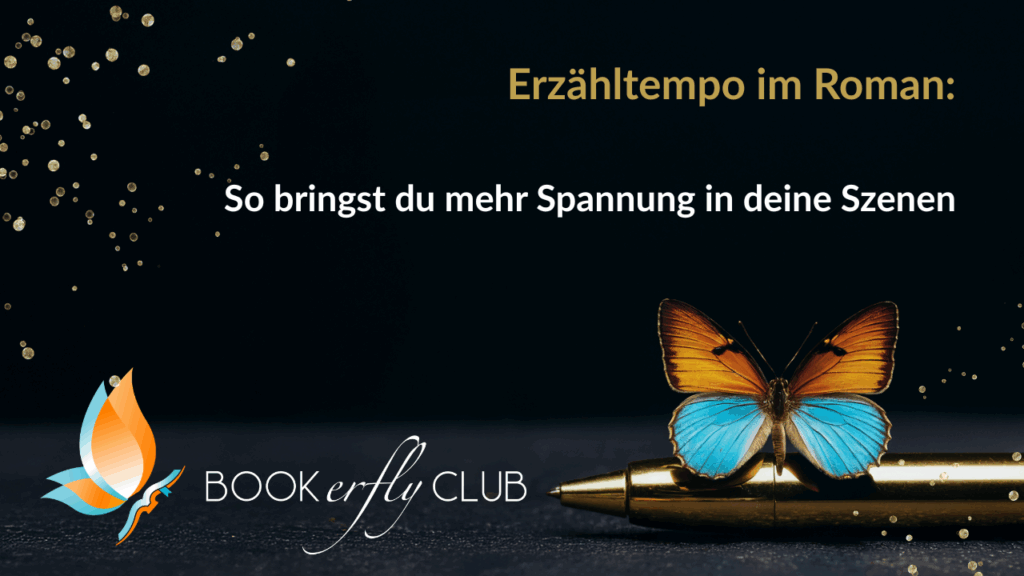
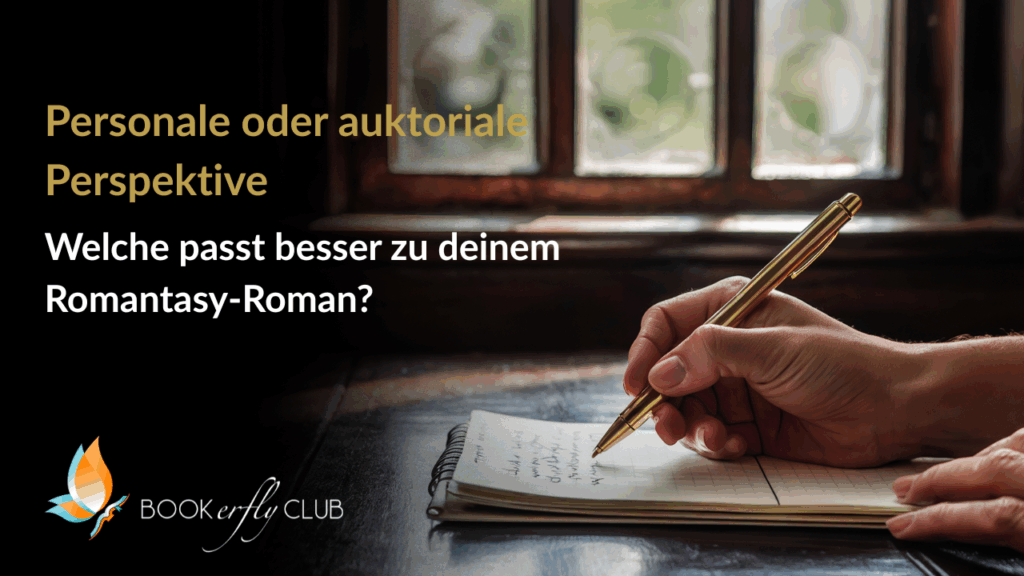

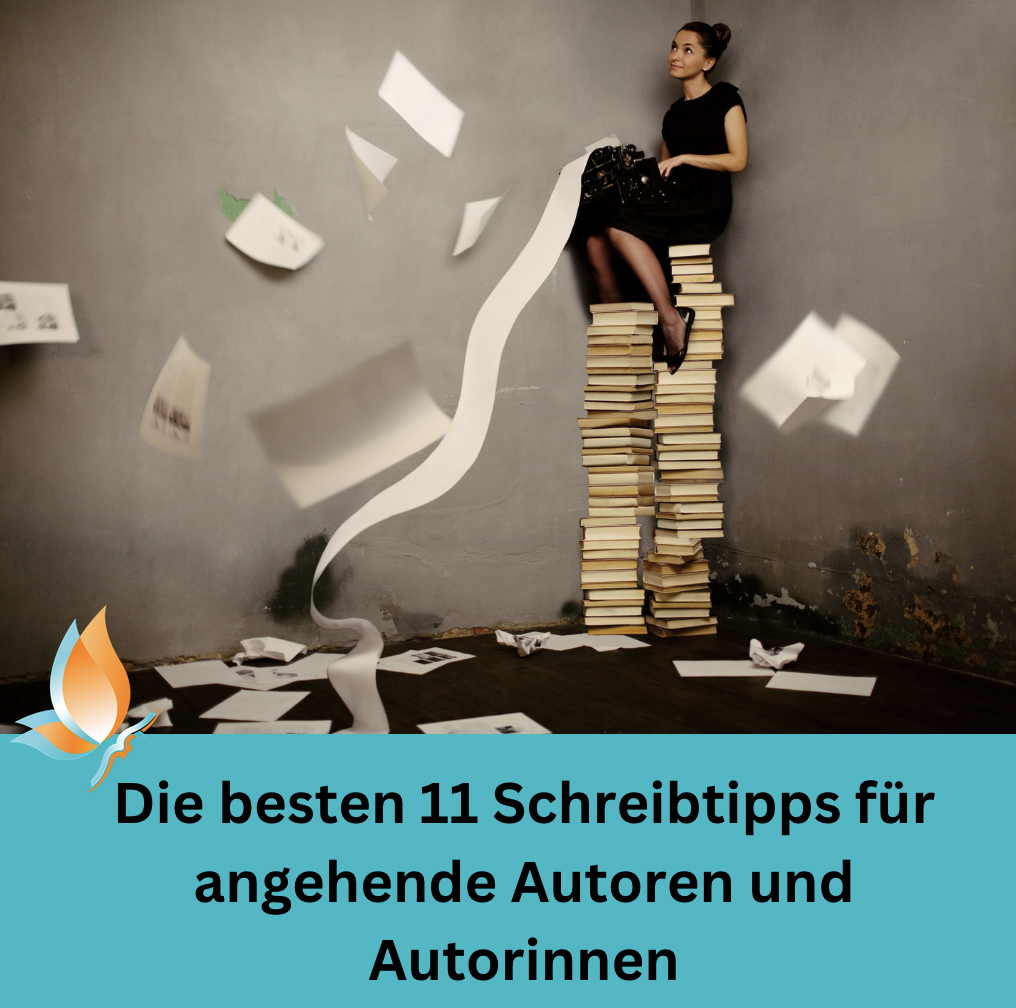
0 Comments